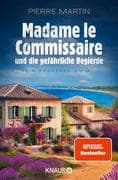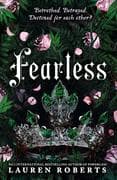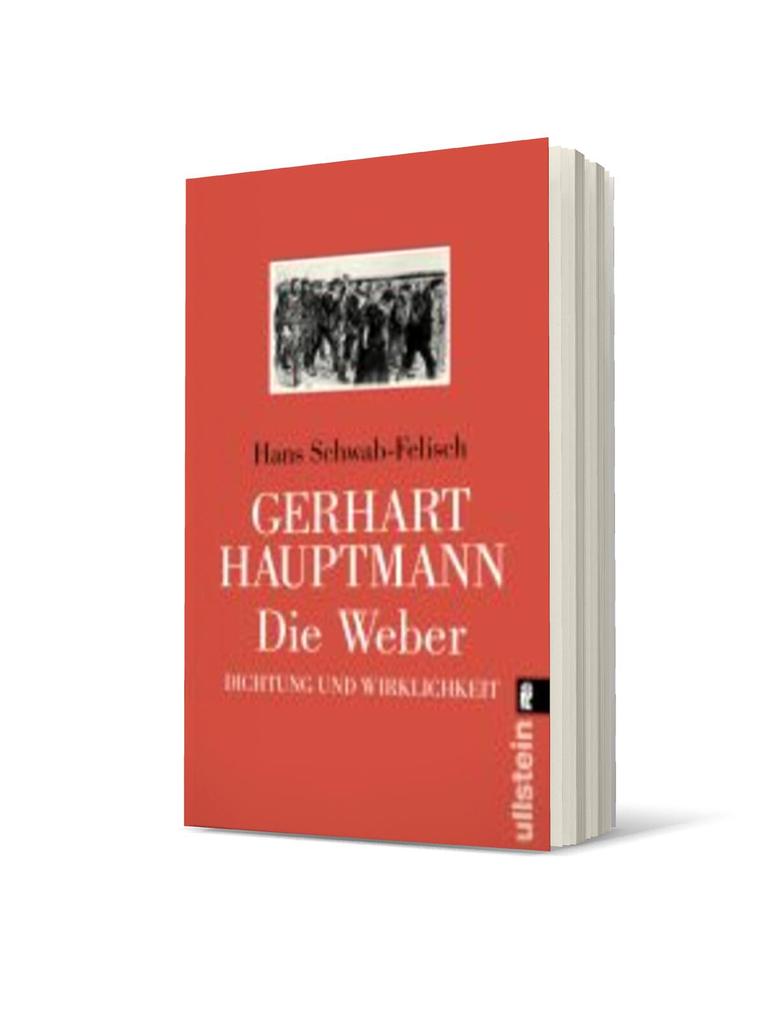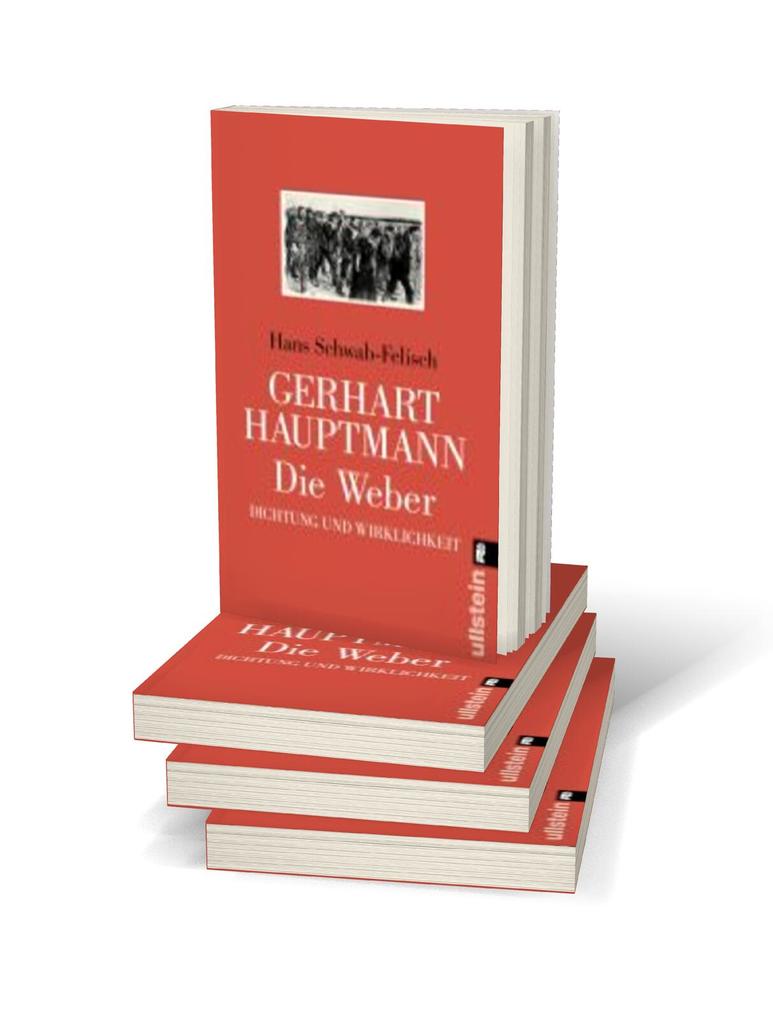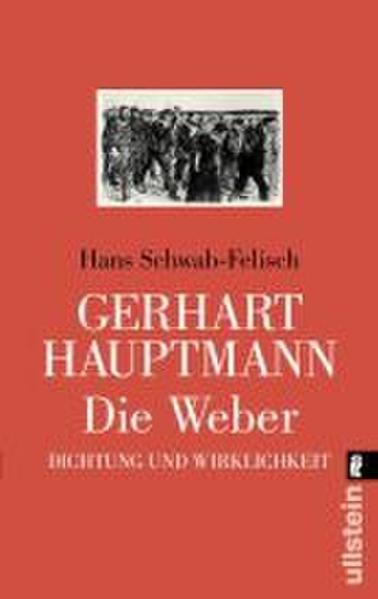
Zustellung: Mo, 28.04. - Mi, 30.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiDie Weber, das wohl bekannteste Werk des deutschen Dramatikers Gerhart Hauptmann, basiert auf dem 1844 mit Militärgewalt niedergeschlagenen Weberaufstand in Schlesien. Am Beispiel einiger junger Figuren - Parchentfabrikant Dreißiger, Weber Moritz Jäger, Pastor Kittelhaus und dem alten Hilse - schildert Hauptmann die Entwicklung des Aufstands bis hin zu seinem blutigen Ende als Drama in fünf Akten.
Neben seinem Essay 'Die Weber - ein Spiegel des 19. Jahrhunderts' hat der Hauptmann-Kenner Professor Hans Schwab-Felisch in diesem Band Dokumentationen zum Weberaufstand, Weberlieder, Artikel und Kritiken zum Drama sowie eine Zeittafel und bibliographische Hinweise versammelt.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
01. Dezember 1996
Sprache
deutsch
Auflage
Auflage
Seitenanzahl
272
Reihe
Ullstein Taschenbuch
Autor/Autorin
Gerhart Hauptmann, Hans Schwab-Felisch
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
260 g
Größe (L/B/H)
185/121/25 mm
ISBN
9783548240473
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
am 30.07.2008
"Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne"
Im Juni 1844 äußern sich die aufgestaute Empörung und das nunmehr erreichte Unvermögen der schlesischen Weber, ihre entbehrungsreiche materielle Situation weiter zu ertragen, in einem Aufstand gegen die Fabrikanten, deren unmenschliche Lohnpolitik die Weber als Quelle ihrer Not, ihres Hungers und Elends ausmachen.
In seinem 1894 uraufgeführten Sozialdrama "Die Weber" verarbeitet Gerhart Hauptmann (1862 - 1946) diese historische Situation literarisch. Im traditionellen Aufbau eines Fünfakters schildert der bedeutendste naturalistische Schriftsteller Deutschlands die Entwicklung der Erhebung - von ihrem spontanen Ausbruch bis hin zur militärischen Niederschlagung - anhand exemplarischer Figuren: Der Parchentfabrikant Dreißiger symbolisiert den kapitalistischen Unternehmer, der im Dienste der Quartalszahlen die finanzielle Unzulänglichkeit der Weber erst bedingt; der Soldat und Weber-Sympathisant Moritz Jäger fungiert als Spiritus Rector des Aufstandes; Pastor Kittelhans repräsentiert die abwiegelnde und vertröstende Haltung der Kirchen zur sozialen Frage; und der alte Hilse steht für die alte Generation der Weber, die alle Not gleichmütig erträgt und aus Gottesfurcht jegliches Aufbegehren verdammt, gegen den verzweifelten Impetus der Jungen aber vergeblich anredet.
Hauptmanns Drama wurde wird noch heute oftmals der Charakter eines sozialistischen Tendenzstücks vorgeworfen, das nicht nur die Not der Weber auf die Bühne bringt und dem Publikum vorstellbar macht, sondern gar zur neuerlichen Revolution aufzurufen intendiere. Gleichwohl diese Auffassung von Hauptmann selbst als schlichtweg falsch zurückgewiesen wurde, kann man dem Stück nicht gänzlich absprechen, gerade dies - wenn auch vom Dichter ungewollt - hervorzurufen: "Die Weber" illustrieren eindrücklich und emotional nahegehend das heutzutage kaum nachvollziehbare Ausmaß der Verarmung der Webersleute. Hier wird verständlich, warum die soziale Frage das politische Sujet des 19. Jahrhunderts schlechthin war.
Allein, dem Lesefluss und damit auch der Empathie des Hochdeutsch gewohnten Lesers ist es durchaus abträglich, dass das Stück zu großen Teilen in - wenn auch entschärftem - schlesischem Dialekt abgefasst ist, was es der historischen Authentizität halber freilich aber auch sein muss.
Dem vollständigen Text des Schauspiels ist in dieser Ausgabe eine ausführliche und informative Dokumentation angefügt, die aus einem sehr gelungenen Essay des Hauptmann-Kenners Hans Schwab-Felisch und umfassendem, Zusatzmaterial besteht. Dieses behandelt unter anderem die historische Situation und den chronologischen Ablauf des Weberaufstandes, die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Hintergründe der Entstehungszeit des Werkes, sowie die Entstehungsgeschichte, Rezeption und das staatliche Zensurverfahren gegen "Die Weber".
In toto sind Hauptmanns ein Prototyp des naturalistischen Sozialdramas und die wohl eingehendste literarische Illustration der sozialen Frage im 19. Jahrhundert.