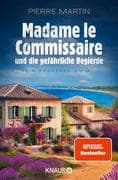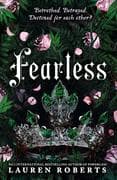Zustellung: Fr, 25.04. - Mo, 28.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiOskar Schindler, der Mann, der während des 2. Weltkrieges über 1300 Juden
vor dem fast sicheren Tod rettete, ist ein Mythos. Wer war er wirklich?
Erstmalig liegen zahlreiche Dokumente und Briefe Schindlers vor, die vor
einem Jahr auf einem Dachboden in Hildesheim entdeckt wurden. Sie geben
neue Einblicke in die dramatischen Ereignisse der damaligen Zeit, aber
auch in Schindlers Leben in der Nachkriegszeit - sie bezeugen seine Kämpfe,
seine immer neuen Versuche, beruflich Fuß zu fassen, in Argentinien, in
Deutschland. Diese Dokumente lassen nicht nur den 'Helden' Schindler in
neuem Licht erscheinen, sondern bringen uns vor allem auch den Menschen
Schindler nahe...
vor dem fast sicheren Tod rettete, ist ein Mythos. Wer war er wirklich?
Erstmalig liegen zahlreiche Dokumente und Briefe Schindlers vor, die vor
einem Jahr auf einem Dachboden in Hildesheim entdeckt wurden. Sie geben
neue Einblicke in die dramatischen Ereignisse der damaligen Zeit, aber
auch in Schindlers Leben in der Nachkriegszeit - sie bezeugen seine Kämpfe,
seine immer neuen Versuche, beruflich Fuß zu fassen, in Argentinien, in
Deutschland. Diese Dokumente lassen nicht nur den 'Helden' Schindler in
neuem Licht erscheinen, sondern bringen uns vor allem auch den Menschen
Schindler nahe...
Produktdetails
Erscheinungsdatum
01. Januar 2000
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
448
Herausgegeben von
Erika Rosenberg
Illustrationen
Erika Herausgegeben von Rosenberg
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
35 Fotos, zahlr. faksimil. Dokumente.
Gewicht
886 g
Größe (L/B/H)
236/164/45 mm
ISBN
9783776622041
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Zucker für die TeufelHöchstens 3000 Zloty, schätzte Oskar Schindler, mehr war das vor ihm stehende Auto nicht wert, denn die Karre war gebraucht, der Zustand nicht der beste. Mindestens 12 000 Zloty, so viel sollte das Auto jetzt wert sein, denn der Verkäufer war SS-Mann und brauchte Geld. Also kaufte der deutsche Judenretter dem SS-Untersturmführer Leo John aus dem Lager Plaszów den Wagen ab ° "um den vierfachen Schätzpreis". Auch dass am nächsten Tag ein SS-Bonze das angeblich kriegswichtige Auto gleich wieder einsackte, nahm Schindler gelassen hin: "Ich war erfreut, beiden Herren gefällig zu sein." Das abgekartete Spiel wird in einem Bericht überliefert, den Schindler vermutlich noch 1945 für die jüdische Hilfsorganisation Joint Jewish Distribution Committee anfertigte und der jetzt zusammen mit anderen Papieren in der ersten Sammlung von Originaldokumenten des Jahrhunderthelden auftaucht. Darin wird erstmals deutlich, mit welchem finanziellen Kraftakt der legendäre Lebensretter seinen Betrieb über Wasser hielt und wie er seine Schützlinge mit Hilfe korrupter SS-Schergen am Holocaust vorbeischmuggelte. Schindlers Aufzeichnungen beschreiben zugleich, wie er notfalls SS-Männer zusammenstauchte. Die größten Posten seiner Mission Menschlichkeit, laut Schindler insgesamt 2,64 Millionen Reichsmark, führt er in dem Bericht an das Joint-Komitee akribisch auf, darunter allein 350 000 Reichsmark für "Bestechungsgelder, Geschenke und Erpressungen" ° nach heutigem Wert gut 2 Millionen Mark. Nicht beziffert, aber penibel vermerkt, sind außerdem die "kleinen Gefälligkeiten": Stoppuhren, Taschenuhren, Fotoapparate, Reitsättel, Schuhe, Stiefelleder, sogar drei Autos ° ein BMW, eine Adler-Limousine, ein Mercedes-Cabrio. Alles Zucker für die Teufel, nur um "die Gangster befriedigt zu haben und in Ruhe gelassen zu werden", wie Schindler 1956 an die israelische Gedenkstätte Jad Waschem schrieb. Enthalten war diese neue, bisher nur in Teilen publizierte Schindler-Liste ° die Kehrseite der berühmten Namensliste mit den 1200 Geretteten ° in jenem Samsonite-Koffer, der vor einem Jahr für eine Weltsensation sorgte. Damals hatte die "Stuttgarter Zeitung" den bei ihr abgelieferten Fund, Schindlers Nachlass, zu einem Sechsteiler verarbeitet, dabei aber vor allem das Scheitern nach dem Krieg beschrieben. Ein Scoop mit Makel: Die Einwilligung der in Argentinien lebenden Schindler-Witwe Emilie, 93, hatte die Zeitung nicht eingeholt. Prompt meldete die Frau Eigentumsansprüche an. Sie setzte die schwäbischen Enthüller unter Druck und erhielt schließlich einen Satz Fotokopien. Das ist jetzt der Stoff, den Schindler-Biografin Erika Rosenberg zum Buch aus dem Koffer verdichtet hat ° darin auch das undatierte Schreiben an das Joint-Komitee. Schindlers Abrechnung setzt mit dem Jahr 1942 ein. Seine Emaillewarenfabrik in Krakau expandiert, die Zahl seiner jüdischen Mitarbeiter steigt von 150 im Jahr 1940 auf 550 im Jahr 1942. Zu diesem Zeitpunkt beginnt im Generalgouvernement die systematische Ausrottung der Juden. Schindler steht vor der Entscheidung, seine Arbeiter in den Tod zu schicken oder in ein eigenes Firmenlager, in dem er die Juden selbst kasernieren muss. 300 000 Reichsmark kostet der Bau, auch Wachtürme und Zäune nach SS-Vorschrift bezahlt Schindler, dazu die Verpflegung vom Schwarzmarkt, 900 000 Reichsmark. Er schleppt Gesunde durch, für die er keine Arbeit hat, und Kranke, die nicht mehr arbeiten können. Vor allem aber erhält er sich "die Gunst der Gebieter über das Schicksal der Juden" ° er scharwenzelt um die SS, schäkert mit der SS, schmiert die SS: "Bestechungen an die höheren SS-Führer, die als Übermenschen begnadet waren, über Leben und Tod zu entscheiden, würden Bände füllen", schreibt Schindler. Allein Amon Göth, psychopathischer Lagerkommandant von Plaszów, kassiert mehr als die Hälfte des Bakschisch. Den Rest stecken der SS- und Polizeiführer von Krakau, Julian Scherner, der Krakauer Sicherheitsdienstchef Rolf Czurda und andere Totenkopfträger ein. Die korrupte Truppe ist vor allem trinkfest. 4000 Liter Schnaps, "falls ausländischen Ursprungs 300 bis 500 Zloty die Flasche", sowie Hunderte Liter Wein verschiebt Schindler zu Hitlers Schergen. Dazu kommen "zahllose so genannte Anleihen der Herren Uniformträger, die sich je nach Frechheit auf Zl. 1000 bis 10 000 beliefen". Und selbst bei Emailletöpfen nutzt des Führers Auslese jede Abzockgelegenheit. Bis zu 30 000 Kilo im Jahr verliert Schindler als angebliche Gratismuster: "Ich lieferte sogar für deren im Reich ausgebombten Tanten und Großmütter." Bevorzugt entwickeln die SS-Leute aber einen feinen kulinarischen Instinkt, wenn Schindler sie braucht: Als die Russen anrücken und er seinen Betrieb 1944 nach Brünnlitz verlagern muss, um seine jüdischen Arbeiter nicht an die Gaskammern zu verlieren, setzt ein reger Präsentkorb-Verkehr ein. "Ausländische Zigaretten, Zigarren, Schnäpse, Bohnenkaffee, Schinken wurden am schwarzen Markt zu astronomischen Preisen gekauft, um ,Liebesgabenpakete' für die Herren erpresserischen Gönner zusammenzustellen", bilanziert Schindler. Nicht nur die SS lässt sich auftischen. "Die Herren der Regierungs- und Wirtschaftsstellen, die vielen kleinen Beamten der Ostbahn, Rüstungskommando, OKH (Oberkommando des Heeres Berlin), die Herren der Hauptausschüsse, Verlagerungsausschüsse, Sonderausschüsse, sie alle hatten Wünsche." Natürlich auch im Arbeitslager Brünnlitz, das dem Lagerkommandanten des KZ Groß-Rosen, Johannes Hassebroek, untersteht. "Dieser war mit seinem Stab bald Stammkunde meines Schnapslagers", vermerkt Schindler lakonisch. Nicht immer verlässt sich Schindler jedoch darauf, dass Schmieren geschmeidig macht; manchmal legt er sich auch brachial mit der SS an. In Brünnlitz wirft er einen schikanösen SS-Rapportführer durch eine geschlossene Glastür. "Er lief, von meinen Hunden gehetzt, zum Gaudium der Arbeiter durch die ganze Halle", erinnert er sich 1956 in einem Brief. Einmal, schreibt Schindler, habe er sogar einen hohen SS-Führer "über die Wendeltreppe rutschen" lassen, der ihm betrunken vorwarf, er konspiriere mit seinen Juden. "Dr. Biberstein (Arzt der Brünnlitzer Krankenstation) hatte Mühe, ihn zusammenzuflicken." Chuzpe und Mutterwitz der Kriegsjahre ° im sarkastischen Ton von Schindlers späteren Briefen scheinen sie wieder auf. Eines aber verkraftet der Nervenstarke nur schwer: "Wer kann meinen inneren Konflikt fühlen, als ich nach und nach ein Dutzend Frauen den Orgien der SS-Übermenschen opferte, denen, wo Alkohol und Geschenke bereits die Zugkraft verloren hatten. Das Leid, welches ich empfand, war bestimmt nicht Eifersucht, es war Ekel vor mir selbst", schreibt Schindler. Die Verbitterung seiner Witwe Emilie ist derweil von anderer Natur. Die Greisin, die Schindler 1957 sitzen ließ, ohne sich je von ihr scheiden zu lassen, will Geld von der "Stuttgarter Zeitung". Nach einem ersten, erfolglosen Anlauf kämpft sie diesmal mit einem starken Verbündeten: der Münchner Verlagsgruppe Langen-Müller-Herbig, der sie über ihre Vertraute Rosenberg die Rechte an den Koffer-Dokumenten übertragen hat. "Wir reichen in Kürze für Frau Schindler eine Schadenersatzklage gegen die 'Stuttgarter Zeitung' ein", kündigt Verlagsleiterin Brigitte Sinhuber an. Begründung für den laut Sinhuber sechsstelligen Streitwert: Verletzung des Urheberrechts. Ohne die Serie in der "Stuttgarter Zeitung" wäre das neue Herbig-Buch ein Weltbestseller geworden, jetzt liegt die Startauflage nur bei 50 000. Sinhuber: "Die Zeitung wollte unbedingt ihre Geschichte ° jetzt muss sie den Preis dafür zahlen." (C) DER SPIEGEL - Vervielfältigung nur mit Genehmigung des SPIEGEL-Verlags
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Ich, Oskar Schindler" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.